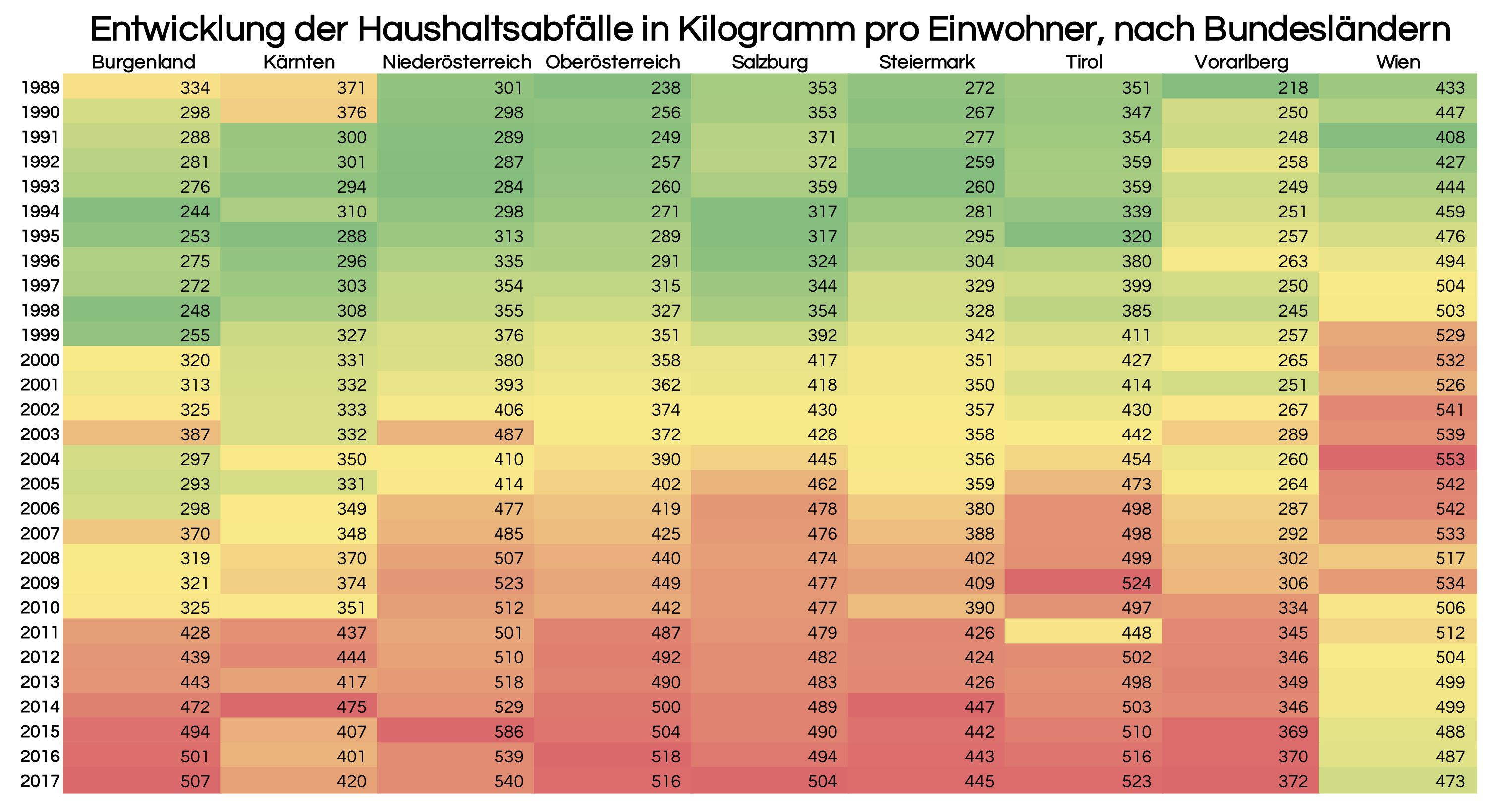Dass Österreich in Zukunft stark Pflegepersonal aufstocken muss, damit es zu keinen Engpässen kommt, ist eindeutig. Aber wie sieht es eigentlich mit den Ärzt*innen hierzulande aus? Im OECD-Vergleich scheint Österreich ein Musterbeispiel zu sein: im Schnitt kommen 5,3 aktive Ärzt*innen auf 1000 Einwohner. Damit liegt Österreich auf Platz zwei hinter Griechenland (6,1) und weit über dem OECD-Schnitt von 3,5 Ärtz*innen. Wie passen diese Spitzenplätze mit den häufigen Warnungen, etwa der Ärztekammer, vor einem bevorstehenden Ärztemangel hierzulande zusammen?
Ein Hintergrund ist die nicht standartisierte Datenerfassung besagter OECD-Studie. Österreich zählt für sie auch Turnusärzt*innen, die sich gerade in Ausbildung befinden, dazu. Andere Staaten melden der OECD hingegen nur bereits fertig ausgebildete Ärzt*innen. Auch Teilzeit-Beschäftigungsverhältnisse, die in Österreich immer häufiger werden, wurden nicht berücksichtigt. Es wurde also nicht, wie es andere Länder zum Teil machen, in entsprechende Vollzeitäquivalente umgerechnet.
Werden nur fertig ausbebildete Ärzt*innen nach Vollzeitäquivalent erfasst, ergibt sich für Österreich eine Ärzt*innendichte von 3,56 pro 1.000 Einwohner, wie das deutsche Forschungsinsitut IGES-Institut errechnet hat. Das würde dem Mittelfeld der OECD-Länder entsprechen, wobei einige andere ebenfalls Daten divergierend einmelden.
Ein Verteilungsproblem?
Aber auch bei dieser Art der Erfassung zeichnet sich eine Herausforderung in Österreich ab: die Ärzt*innen sind innerhalb des Landes ungleich verteilt. Für junge Mediziner*innen ist die Arbeit am Land unattraktiv. Die Anzahl der Landärzt*innen sinkt. Diese Datenvisualisierung zeigt, die Verteilung der Ärzt*innendichte in Österreich:
Auffallend ist dabei die vergleichsweise höhrere Ärztedichte in Wien (6,84) und Tirol (5,87) sowie die geringere in Vorarlberg (4,31) und Oberösterreich (4,25). Wie lange die Wartezeiten und die Anreise für medizinische Versorgung ist und wie umfassend die (zeitlichen) Ressourcen pro Patient*in, wird laut Ärztekammer schon von diesen Unterschieden zwischen rund sieben und vier Ärzt*innen pro 1000 Einwöhner*innen deutlich beeinflusst.
Außerdem ist die Datenlage ansich auch hier erwähnenswert: die Ärzt*innendichte wird nämlich nur nach Bundesland und nicht etwa nach Gemeinde oder Region erfasst. Dadurch ist nicht erkennbar, ob etwa die Landeshauptstädte eine höhere Ärzt*innendichte haben und so den Schnitt für das Bundesland erhöhen. Rückschlüsse auf Versorgungsunterschiede zwischen Stadt und Land können aus den Daten nicht getroffen werden. Der Trend zur Landflucht auch bei Ärzt*innen liegt nahe und wird immer wieder durch Warnungen von (Regional)politik, Ärztekammer, wie auch durch Medienberichte bestätigt. Eine genauere Datenerfassung wäre dennoch wünschenswert, um ihn ein für alle Mal zu belegen und vor allem eindeutiger besonders betroffene Regionen erkennen zu können.
Kassenverträge sind unattraktiver
Neben der geographischen Verteilung der Mediziner*innen in Österreich ist noch eine weitere relevant: das Verhältnis zwischen Kassenärzt*innen und Wahlärzt*innen. 2020 waren 157 Kassenstellen in Österreich unbesetzt. Das sind 28 mehr als 2019. Fehlende Allgemeinmediziner*innen haben dabei zwei Drittel (95) der freien Kassenverträge ausgemacht, der Rest Fachärzt*innen.
Patient*innen müssen also immer häufiger zu Wahlärzt*innen ausweichen. Zwar nimmt die Ärzt*innendichte seit 1960 beinahme konstant zu – 1960 kamen (ohne Berücksichtigung von Vollzeitäquivalenten und mit Turnusärzt*innen) noch rund 1,6 Ärzt*innen auf 1.000 Einwohner*innen, 2019 waren es bereits 5,3 – aber die Dichte der Kassenärzt*innen nimmt ab.
Das zeigt auch diese Grafik, die den Bevölkerungszuwachs und die Entwicklung der Allgemeinmediziner*innen mit Ordination, die einen Kassenvertrag haben, gegenüberstellt:
(Allgemeinmediziner*innen ist synonym für den umgangssprachlichen Begriff Hausärzt*innen zu verstehen.)
Auch wenn die absolute Anzahl der Mediziner*innen also in Österreich kontinierlich steigt, sinkt die der Allgemeinmediziner*innen mit Kassenvertrag. Auch für die gesamte Anzahl der Allgemeinmediziner*innen gilt das übrigens in den letzten zehn Jahren (Quelle: zweite Grafik). Und weil gleichzeitig die Bevölkerungsanzahl wächst, kommen letztendlich immer weniger niedergelassene Allgemeinmediziner*innen mit Kasse auf mehr Menschen. Ein Beispiel: In Wien ist die Einwohner*innenzahl seit 2010 um 200.000 gestiegen, gleichzeitig gab es 2019 71 Hausärzt*innen mit Kassenvertrag weniger.
Eine Zwei-Klassen-Medizin?
Kassenverträge sind weniger attraktiv – zumindest was die Arbeitsbedingungen und die Gehälter angeht. Sie bedeuten meist: weniger Zeit und Geld für mehr Patient*innen. Für eben jene bedeuten weniger Kassenärzt*innen im Umkehrschluss: eine Kostenverschiebung in den privaten Bereich, weil Kassen vielfach nur ein Bruchteil der Behandlungskosten rückerstatten. So bleibt nur die Wahl zwischen mehr Eigenkosten durch den Gang zum Wahlarzt bzw. der Wahlärztin und längeren Wartezeiten auf einen Termin. Viele haben diese Wahl aber nicht. Sie können sich den Wahlarztbesuch kaum oder nicht leisten. Eine Zwei-Klassen-Medizin entsteht.
Wer es sich leisten kann bekommt schneller eine Behandlung und besucht Wahlärzt*innen, die sich mehr Zeit für Beratung und Untersuchung nehmen können. Für den Rest ist Österreich zwar trotzdem immer noch ein Land, in der nötige medizinische Versorgung und Behandlung in guter Qualität (beinahe) kostenfrei sichergestellt ist. Aber eben immer öfter mit längeren Wartezeiten und weniger Zeit für eine – nicht zu unterschätzende – umfassende Aufklärungen von Patient*innen.
Die Anzahl der niedergelassenen Ärzt*innen ohne Kassenvertrag hat dabei in Österreich, die jener mit Kasse bereits 2007 überschritten:
Dieser Trend zum Wahlarzt bzw zur Wahlärztin muss allerdings teilweise relativiert werden: auch bei dieser Statistik wird die absolute Anzahl der Ärzt*innen ohne Berücksichtigung von Teilzeitbeschäftigungen erfasst. In Österreich arbeitet aber ein Drittel der Ärzt*innen Teilzeit.
Anteil der Fächärzt*innen ohne Kassenvertrag wächst deutlich
Gerade Wahl*ärztinnen machen einen großen Anteil der Teilzeitarbeitenden aus. Sie sind oft im Spital- und Rettungswesen beschäftigt und haben zusätzlich eine private Ordination, in der sie zusätzlich einige Stunden arbeiten. Das ist auch mit ein Grund, wieso der Anteil der Fachärzt*innen ohne Kassenvertrag am stärksten steigt:
Diese Grafik zeigt: Hintergrund des Zuwachses an niedergelassenen Ärzt*innen sind vor allem Fachärzt*innen, also etwa von Gynäkolog*innen, Neurolog*innen und Hautärzt*innen, die keinen Kassenvertrag haben. Diese Entwicklung ist aber zu stark, um sie nur auf mehr Mediziner*innen, die zusätzlich zum Job im Spital- und Rettungswesen Teilzeit arbeiten, zurückzuführen. In der Allgemeinmedizin gibt es weiterhin mehr Ärzt*innen mit Kasse, als ohne. Jene mit Kasse sind leicht zurückgegangen, jene ohne etwas mehr geworden. Und Fachärzt*innen mit Kassenvertrag sind praktisch stagniert.
Allgemeinmedizin und Kasse sind also beide in der Regel unattraktiver. Es ist eine Entwicklung, die schon heute vielen Menschen in Österreich in ihrem Alltag wahrnehmen. Eine Krankschreibung beim Allgemeinarzt ist in der Regel kein Problem. Im Fachärzt*innenbereich kennen viele die Suche nach guten Kassenärzt*innen mit freien Plätzen, lange Wartelisten und Terminausbuchungen für Monate voraus bereits heute allzu gut. Und auch hier lohnt sich ein Vergleich der Entwicklung der Bundesländer:
Besonders stark ist der Anteil der Wahlärzt*innen im Facharztbereich in Oberösterreich (+14%) und Wien (+12%) gestiegen. Niederösterreich verzeichnet hingegen sogar einen Rückgang des Anteils von Fachärzt*innen die keine Kasse haben um zwei Prozent. Damit sticht das Bundesland zum zweiten Mal als Ausreißer heraus: auch die Allgemeinmediziner*innen mit Kassenvertrag gab es nur in Niederösterreich seit 2010 einen Zuwachs (siehe erste Grafik des Beitrags). Warum das so ist, lässt sich leider nicht aus den Daten herauslesen.
Ins eigene Geldbörsl greifen
Obwohl der Trend weg von der Kasse und weg vom Land nichts gutes verheißt, muss an dieser Stelle gesagt werden: Österreich gilt zurecht als ein Land mit guter Gesundheitsversorgung – und auch eines, in der sie allen zugänglich ist. Anders als etwa in den USA sind fast alle Menschen krankenversichert. Arbeitgeber*innen sind dazu verpflichtet. Wer es nicht ist, wird von Vereinen und NGOs trotzdem versorgt. Das sollte die Regel sein, ist weltweit gesehen aber eher die Ausnahme.
Vergleichen wir Österreich aber mit der EU, übernehmen Privathaushalte im Schnitt allerdings einen etwas größeren Anteil der Gesundheitsausgaben. Das zeigt diese Grafik:
Mit drei Prozent mehr, ist der Unterschied natürlich nicht extrem. Er widerlegt aber die weitverbreitete Annahme, dass Österreich auch innerhalb der EU ein Gesundheitswesen mit besonders geringer Übernahme als Privatleistung hat. Unter die Kategorie “Sonstiges”, in der Österreich den größten Unterschied verzeichnet, fallen dabei übrigens auch die Ausgaben für Wahlärzt*innen.
Und der Nachwuchs?
Dass es weniger Land- und Kassenärzt*innen gibt liegt vor allem an den neu hinzukommenden Jungmediziner*innen. Und genau diese erwartet eine weitere Herausforderung: In den nächsten zehn Jahren überschreiten 14.581 Ärzt*innen das Pensionsalter. So waren 2019 rund 19% der Ärzt*innen unter 35 Jahren alt und rund 30% über 55, wie diese Grafik zeigt:
Die Österreichische Ärztekammer hat aufgrund dieser Daten vor einem drohenden Ärztemangel gewarnt: es ergebe sich durch die zu erwartenden Pensionierungen ein jährlicher Nachbesetzungsbedarf von 1.458 Stellen im Jahr, alleine, “um eine Aufrechterhaltung des Status-quo der Kopfzahl zu gewährleisten”. Sprich: ohne Bevölkerungswachstum miteinzurechnen. Der Nachwuchs reiche – so die Ärztekammer – für diesen erwarteten Nachbesetzungsbedarf bei Weitem nicht aus. Gleichzeitig gehen 40% der Medizinstudent*innen an österreichischen Universitäten nach dem Studiumabschluss ins Ausland. Darunter nicht nur jene, die zum Studieren zugezogen sind, sondern auch zunehmend mehr Österreicher*innen, die ein Medizinstudium abschließen.
Fazit
Die verfügbaren Daten belegen Probleme, vor denen auch Interessensvertretungen immer wieder warnen. Kassenverträge sind zu unattraktiv, genauso wie Arbeit am Land. Bevorstehende Pensionierungswellen bringen den Bereich noch mehr unter Druck. Zusätzlich wächst die Bevölkerung Österreichs und wir werden immer älter. Dadurch braucht es auch mehr Ärzt*innen, gleichzeitig sinkt aber die Anzahl jener, die nach dem Medizinstudium in Österreich praktizieren.
Was gegenwirken könnte, sind poltische Maßnahmen. Von Anreizsystemen, wie Stipendien und eigenen Studienplätzen für Medizinstudierende, die später im ländlichen Raum arbeiten, über neue Versorgungsmodelle wie Gemeinschaftspraxen bis hin zur Attraktivitätssteigerung von Kassenverträgen, gibt es hierfür viele Lösungsvorschläge. Das würde auch die Ärzt*innen in Spitälern entlasten. Denn lange Terminausbuchungen und sinkende Kassenangebote tragen auch dazu bei, dass Patient*innen in Österreich zunehmend eine weitere Option wählen: das Aufsuchen eines Spitals. Besonders in den Großstädten wird dort über volle Notfallambulanzen und stundenlange Wartezeiten geklagt.